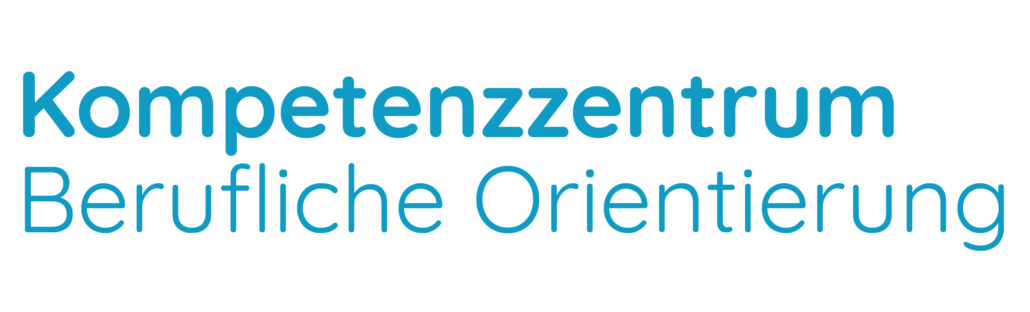Geld ist weit mehr als eine Zahl auf dem Konto. Es entscheidet mit darüber, wie sicher wir uns fühlen, welche Chancen wir wahrnehmen – und welche Sorgen uns nachts wachhalten. Die neue IU Studie „Finanzielles Wohlbefinden“ zeigt eindrucksvoll, wie Menschen in Deutschland aktuell über ihre finanzielle Zukunft denken und welche Ziele sie bewegen. Von der Generation Z bis zu den Babyboomern: Jede Altersgruppe bringt ihre eigenen Hoffnungen, Ängste und Prioritäten mit. Vorab: Wenn es um Geld geht, wollen junge Menschen in Deutschland vor allem eines: finanziell unabhängig sein.
Wirtschaftliche Lage: Ein geteiltes Gefühl von Unsicherheit
Der Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Situation fällt für viele besorgniserregend aus. Jede:r Zweite in Deutschland macht sich aktuell Sorgen um die wirtschaftliche Lage. Besonders deutlich wird dieser Trend bei den Babyboomern: 61,1 Prozent dieser Generation blicken mit Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung – ein Wert, der zeigt, wie stark äußere Einflüsse das persönliche Sicherheitsgefühl formen.
Persönliche Finanzlage: Zwischen Zufriedenheit, Unsicherheit und Hoffnung
Die eigene finanzielle Situation löst sehr unterschiedliche Emotionen aus.
-
30,9 % der Befragten empfinden Zufriedenheit.
-
Fast genauso viele – 30,2 % – fühlen sich unsicher.
Die jüngste Erwachsenen-Generation, die Generation Z, zeigt sich etwas hoffnungsvoller: 26,9 % geben an, mit Zuversicht in ihre finanzielle Zukunft zu blicken – häufiger als jede andere Generation. Gleichzeitig kämpft die Generation Y überdurchschnittlich oft mit Frustration (21,4 %). Hier spiegelt sich eine Lebensphase wider, in der viele gleichzeitig Karriere, Familienplanung und steigende Lebenshaltungskosten jonglieren.
Finanzielle Ziele: Der Wunsch nach Unabhängigkeit dominiert
Welche Träume und Ambitionen treiben die Menschen an? Die Studie zeigt ein klares Bild:
-
58,9 % streben finanzielle Unabhängigkeit an – ein Ziel, das quer durch alle Generationen hohe Bedeutung hat.
-
51,4 % nennen die Altersvorsorge als Priorität, ein Thema, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wieder stärker in den Fokus rückt.
Auffällig ist die Generation Z: Sie formuliert häufiger als andere den Wunsch nach persönlicher Freiheit, der Erfüllung individueller Lebensziele, einem eigenen Haus oder Investitionen in Bildung. Diese Generation möchte gestalten – und sieht Geld als Möglichmacher.
Hürden auf dem Weg: Überblick und Einfluss von Social Media
Doch nicht nur Ziele, auch Herausforderungen prägen das finanzielle Wohlbefinden. Besonders junge Menschen kämpfen mit fehlender Transparenz über ihre Finanzen: 16,3 % der 16- bis 30-Jährigen geben an, keinen vollständigen Überblick über ihre finanzielle Situation zu haben.
Hinzu kommt ein deutlich erkennbarer Einfluss sozialer Medien: Die Generation Z lässt sich doppelt so häufig wie Babyboomer bei finanziellen Entscheidungen durch Social-Media-Inhalte beeinflussen. Trends wie „FinTok“, Krypto-Hypes oder Lifestyle-Content zeigen Wirkung – oft inspirierend, manchmal aber auch irreleitend. Mehr dazu beleuchtet das Fokusthema „Die junge Generation und das liebe Geld“ der Studie.
Expert:innen-Insights: Wie lässt sich finanzielles Wohlbefinden stärken?
Im begleitenden Interview liefert Prof. Dr. Johannes Treu, Professor für Allgemeine BWL und VWL an der IU Internationalen Hochschule, praxisnahe Einschätzungen und Tipps. Sein Fazit: Finanzielles Wohlbefinden entsteht nicht nur durch Einkommen oder Rücklagen, sondern vor allem durch Kompetenz, klare Ziele und informierte Entscheidungen. Wer seine Finanzen versteht, behält die Kontrolle – und gewinnt Sicherheit.
Fazit: Finanzielles Wohlbefinden ist ein Spiegel unserer Zeit
Die IU Studie zeigt: Unsere Einstellung zu Geld ist ein Zusammenspiel aus wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, persönlicher Lebensphase und individuellen Zielen. Während Sorgen allgegenwärtig bleiben, wächst gleichzeitig der Wunsch nach Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und finanzieller Bildung.
Geld mag nicht alles sein – aber es beeinflusst vieles. Und genau deshalb lohnt sich der Blick auf das eigene finanzielle Wohlbefinden heute mehr denn je.