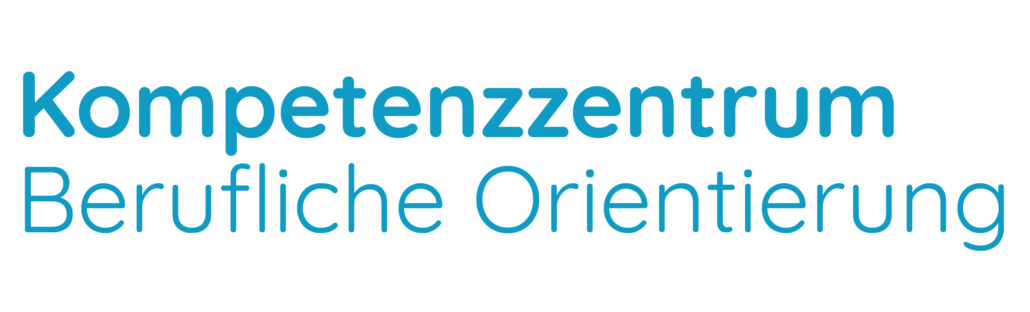Einleitung:
Die Orientierung bei der Berufswahl stellt nach wie vor ein zentrales Problem dar, das viele Jugendliche vor große Herausforderungen stellt. Trotz der Vielzahl an Informationen und Ressourcen beklagen mehr als die Hälfte aller befragten Jugendlichen – satte 55 Prozent – dass es ihnen schwerfällt, sich in der Fülle der verfügbaren Informationen zurechtzufinden. Diese Schwierigkeiten manifestieren sich in einem klaren Bedarf nach mehr Unterstützung und Hilfestellung bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft. Es ist alarmierend zu erfahren, dass fast ein Drittel derjenigen, die bereits Erfahrungen mit der Suche nach einem Ausbildungsplatz gemacht haben, sich mehr Unterstützung wünschen, während weitere 42 Prozent zumindest teilweise diesen Bedarf äußern.
Um die Übergänge zwischen Schule und Berufsleben zu verbessern, ist jedoch nicht nur eine ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen erforderlich. Vielmehr brauchen insbesondere diejenigen jungen Menschen, die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben, eine individuelle und kontinuierliche Begleitung. Es ist entscheidend, dass die entsprechenden Angebote flexibel verfügbar sind, um bestmöglich auf die jeweilige Situation der Jugendlichen eingehen zu können.
Angesichts dieser Herausforderungen ist es dringend geboten, die Berufliche Orientierung zu optimieren und effektive Strategien zu entwickeln, um Jugendlichen eine fundierte Grundlage für ihre berufliche Zukunft zu bieten. In diesem Kontext ist es von entscheidender Bedeutung, die Gelingensbedingungen für die Berufliche Orientierung genau zu analysieren und konkrete Maßnahmen zu identifizieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Meine nachfolgenden Gedanken widmen sich den Gelingensbedingungen für eine effektive Berufliche Orientierung aus meiner persönlichen Sicht.
- Soziale Kompetenzen stärken:
Ein alter Hut? Ja stimmt, dennoch: In der heutigen Zeit wird immer deutlicher, dass viele Jugendliche Schwierigkeiten mit sozialen Kompetenzen haben. Es mangelt an Werten wie Verantwortung, Fairness und Zusammenarbeit. Eine „Ich-ich-ich-Gesellschaft“ scheint sich zu manifestieren. Besonders in benachteiligten Schichten fehlt es an Unterstützung. Eine individuelle Betreuung und Begleitung ist unerlässlich, um Jugendlichen zu helfen, in der Berufs- und Arbeitswelt klarzukommen.
Es ist daher dringend erforderlich, Programme zur Stärkung sozialer Kompetenzen in Schulen zu implementieren. Diese Programme sollten nicht nur auf theoretischem Wissen basieren, sondern praktische Übungen und Erfahrungen einschließen. Zudem ist es wichtig, Lehrkräfte und andere Betreuungspersonen entsprechend zu schulen, um Jugendlichen besser dabei helfen zu können, soziale Fähigkeiten zu entwickeln.
- Individualisierung der Beruflichen Orientierung:
Während standardisierte Elemente in der Beruflichen Orientierung einen gewissen Rahmen bieten können, ist es entscheidend, dass diese nicht als starre Vorgaben betrachtet werden. Jeder Jugendliche hat individuelle Stärken, Interessen und Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen.
Es ist notwendig, die Berufliche Orientierung zu individualisieren und maßgeschneiderte Programme anzubieten, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Ziele der Jugendlichen zugeschnitten sind. Dies kann bedeuten, dass Standardelemente als Optionen angeboten werden, anstatt als verpflichtende Schritte. Dadurch wird den Jugendlichen mehr Freiheit und Motivation gegeben, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.
- Externe Begleitung und Unterstützung:
Schulen allein können oft nicht ausreichend wirksame Programme zur Beruflichen Orientierung anbieten. Externe Organisationen und Kompetenzzentren können eine wertvolle Ergänzung sein, um Jugendlichen, aber auch Lehrkräften und Eltern zusätzliche Unterstützung und Orientierung zu bieten.
Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler benötigen verstärkt externe Begleitung und Unterstützung. Diese Organisationen können maßgeschneiderte Programme entwickeln und umsetzen, die auf die lokalen Bedürfnisse und Herausforderungen zugeschnitten sind. Dabei ist es wichtig, dass diese Programme nicht nur einmalig, sondern kontinuierlich und flexibel angeboten werden, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
- Früher Beginn der Beruflichen Orientierung:
Die Berufliche Orientierung sollte nicht erst in den höheren Schuljahren beginnen, sondern bereits in frühen Schuljahren, idealerweise ab der 5. Klasse. Frühe Orientierung ermöglicht es den Jugendlichen, ihre Interessen und Stärken frühzeitig zu erkunden und eine fundierte Entscheidung über ihre berufliche Zukunft zu treffen.
Frühe Orientierung sollte spielerisch erfolgen, um den Schülern eine positive Erfahrung zu ermöglichen und sie für die späteren Schritte in der Beruflichen Orientierung zu motivieren. Dabei können verschiedene Aktivitäten, Projekte und Exkursionen eingesetzt werden, um den Schülern vielfältige Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen.
- Praxisphasen und externe Unterstützung:
Praxiserfahrungen sind von entscheidender Bedeutung für die Berufliche Orientierung, da sie den Jugendlichen helfen, ihre entdeckten Stärken in der realen Arbeitswelt zu erproben. Allerdings darf die Verantwortung nicht allein den Unternehmen überlassen werden, solche Praxisphasen anzubieten.
Externe Organisationen wie zdi’s oder Schülerlabore können wichtige Partner sein, um Jugendlichen Praxisphasen zu ermöglichen und sie auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Diese Organisationen sollten über Expertise und Kontakte in der Wirtschaft verfügen, um den Jugendlichen relevante Einblicke und Unterstützung zu bieten.
- Einbeziehung verschiedener Akteure:
Die Berufliche Orientierung sollte nicht nur auf die Schulen beschränkt sein, sondern auch andere wichtige Akteure wie Eltern, Freunde und Lehrkräfte einbeziehen. Diese Akteure spielen eine wichtige Rolle im Berufsfindungsprozess der Jugendlichen und sollten proaktiv unterstützt werden.
Es ist wichtig, verschiedene Informations- und Unterstützungsangebote bereitzustellen, die diese Akteure erreichen und ihnen helfen, die Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehören Informationsveranstaltungen, Workshops, Online-Ressourcen und persönliche Beratungsgespräche.
- Koordinierung und lokale Bildungslandschaft:
Die Koordinierung der Berufsorientierung auf lokaler Ebene ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle relevanten Akteure zusammenarbeiten und sich ergänzen. Kommunale Koordinierungen sollten daher nicht nur koordinieren, sondern auch aktiv in die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen eingreifen.
Durch eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Organisationen und Einrichtungen können bedarfsgerechte Angebote geschaffen werden, die die Berufliche Orientierung verbessern und die Übergänge zwischen Schule und Arbeitswelt erleichtern. Dabei ist es wichtig, dass die Koordinierungsstellen die lokalen Bedürfnisse und Herausforderungen genau kennen und entsprechend handeln.
Zusammenfassung und Fazit:
Die Berufliche Orientierung für Jugendliche ist von entscheidender Bedeutung für ihren erfolgreichen Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen und Defizite, denen viele Jugendliche gegenüberstehen, ist es unerlässlich, dass wir uns auf die Verbesserung der Gelingensbedingungen konzentrieren. Durch eine umfassende Herangehensweise, die verschiedene Aspekte berücksichtigt, können wir Jugendlichen eine solide Grundlage für ihre berufliche Zukunft bieten.
Die Stärkung sozialer Kompetenzen ist ein grundlegender Schritt, um Jugendliche auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Programme zur Förderung von Werten wie Verantwortung, Fairness und Zusammenarbeit sollten in Schulen implementiert werden, um den Jugendlichen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um erfolgreich in der Arbeitswelt zu agieren.
Die Individualisierung der Beruflichen Orientierung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Jugendliche haben individuelle Stärken, Interessen und Bedürfnisse, die bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft berücksichtigt werden müssen. Standardisierte Elemente sollten daher als Optionen angeboten werden, anstatt als verpflichtende Schritte, um den Jugendlichen mehr Freiheit und Motivation zu geben, sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.
Externe Begleitung und Unterstützung sind unerlässlich, um Jugendlichen eine ganzheitliche Unterstützung und Orientierung zu bieten. Schulen allein können oft nicht ausreichend wirksame Programme zur Beruflichen Orientierung anbieten, daher ist es wichtig, dass externe Organisationen und Kompetenzzentren eingebunden werden, um maßgeschneiderte Programme anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen gerecht werden.
Ein früher Beginn der Beruflichen Orientierung, idealerweise bereits ab der 5. Klasse, ermöglicht es Jugendlichen, frühzeitig ihre Interessen und Stärken zu erkunden und fundierte Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft zu treffen. Durch spielerische Ansätze können positive Erfahrungen geschaffen und die Motivation der Jugendlichen gesteigert werden.
Praxisphasen und externe Unterstützung sind entscheidend, um Jugendlichen praktische Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen und sie auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Externe Organisationen können wichtige Partner sein, um Jugendlichen Praxiserfahrungen zu ermöglichen und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
Die Einbeziehung verschiedener Akteure wie Eltern, Freunde und Lehrkräfte ist ebenfalls von großer Bedeutung. Diese Akteure spielen eine wichtige Rolle im Berufsfindungsprozess der Jugendlichen und sollten proaktiv unterstützt werden.
Die Koordinierung der Berufsorientierung auf lokaler Ebene ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle relevanten Akteure zusammenarbeiten und sich ergänzen. Kommunale Koordinierungen sollten daher nicht nur koordinieren, sondern auch aktiv in die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen eingreifen.
Insgesamt erfordert die Verbesserung der Beruflichen Orientierung eine gemeinsame Anstrengung von Schulen, externen Organisationen, Eltern und anderen wichtigen Akteuren. Nur durch eine ganzheitliche Herangehensweise können wir Jugendlichen eine solide Grundlage für ihre berufliche Zukunft bieten und sie dabei unterstützen, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.
Christoph Sochart,
im März 2024