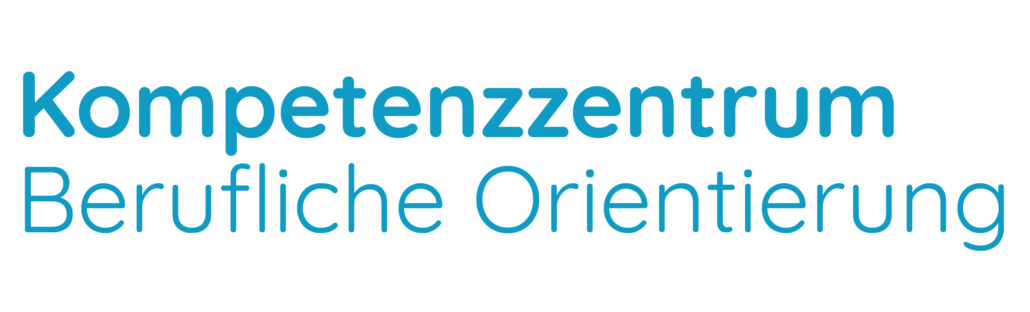Jedes Jahr beginnen fast 250.000 Jugendliche in Deutschland staatlich geförderte Maßnahmen im sogenannten Übergangssektor. Dabei handelt es sich um Praktika in Betrieben, Qualifizierungskurse oder das Nachholen von Schulabschlüssen, weil sie nach der Schule keinen Ausbildungsplatz finden oder ihnen wichtige Kompetenzen fehlen. Gleichzeitig blieben 2024 fast 70.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt: Viele dieser Jugendlichen wären in der Lage, direkt eine Ausbildung aufzunehmen – ein Teil davon mit entsprechender Begleitung.
Die Ergebnisse basieren auf einer bundesweiten Befragung von 1.540 Fachkräften, die Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen. Dazu gehören Mitarbeitende in Jobcentern, Berufsschulen, Bildungsträgern und Einrichtungen der Jugendhilfe. Ihre Einschätzung: Rund ein Viertel der Jugendlichen im Übergangssektor könnte sofort eine Ausbildung beginnen, wenn es den passenden Ausbildungsplatz für sie gäbe (26,3 Prozent). Mehr als ein Drittel der Jugendlichen würde den Sprung ins Berufsleben schaffen, wenn sie dabei professionell begleitet würden (36,4 Prozent). Lediglich 37,3 Prozent der jungen Menschen bräuchten nach Ansicht der Fachleute weiterhin vorbereitende Maßnahmen, bevor sie eine Ausbildung antreten könnten.
„Für rund ein Drittel der jungen Menschen im Übergangssektor sind dessen Angebote sinnvoll. Die große Mehrheit aber könnte – teils mit Unterstützung – direkt in eine Ausbildung starten, anstatt eine staatlich geförderte Maßnahme absolvieren zu müssen“, erklärt Clemens Wieland, Experte für berufliche Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. „Mit Blick auf den Fachkräftemangel, aber vor allem im Interesse der Jugendlichen selbst, sollte dieses Potenzial unbedingt genutzt werden.“
Die Studie macht deutlich, dass es mehr individuelle Unterstützung für junge Menschen beim Start ins Berufsleben braucht. Unternehmen, Bildungseinrichtungen und die Politik sind gefragt, passende Ausbildungsplätze bereitzustellen und gezielte Begleitangebote zu schaffen. Nur so kann verhindert werden, dass motivierte Jugendliche unnötig lange im Übergangssektor verbleiben, anstatt direkt ins Berufsleben zu starten.