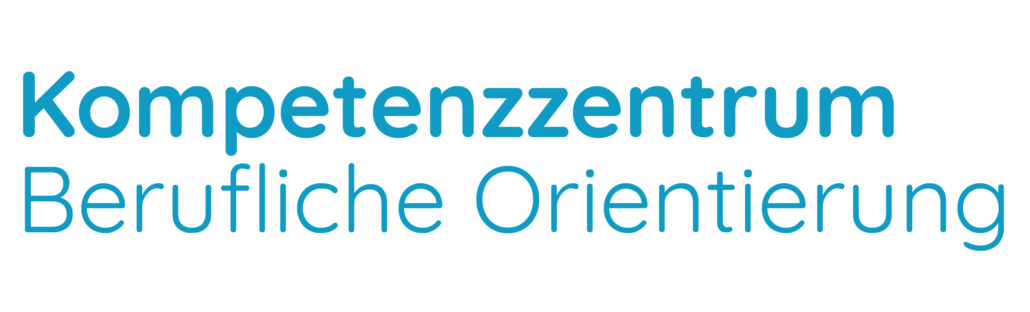Warum muss uns erst Corona zum digitalen Lernen zwingen?
In ganz Deutschland sind die Schulen seit gestern geschlossen. Für das Bildungssystem ist das eine enorme Herausforderung: Die Kinder müssen weiterhin betreut, der Unterrichtsausfall kompensiert werden. Viele Bundesländer wollen auf digitale Alternativen setzen und Unterrichtsmaterial etwa per E-Mail verschicken – doch dazu fehlt die nötige Kompetenz und Infrastruktur. Im BLOG heute ein Artikel von David Meinhard vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln.
In der Nacht zum Freitag, 13. März 2020, beschloss das Saarland als erstes deutsches Bundesland, alle Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. Im Laufe des Tages und des Wochenendes taten es alle anderen Bundesländer dem Saarland gleich. Seit Anfang dieser Woche sind alle Schulen in Deutschland geschlossen. Doch wie sollen die Schüler jetzt lernen? Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus beispielsweise empfiehlt digitale Medien, „um ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbeiten zu können.“ Schulleiter sollen die „digitalen Möglichkeiten“ ihrer Schulen prüfen.
Das Coronavirus offenbart ein grundsätzlich verkürztes Verständnis
des Einsatzes digitaler Medien: Gibt es Personalmangel, Raumnot oder,
wie in diesem Fall, eine gesundheitliche Krisensituation, sollen
E-Learning und Co. zum Einsatz kommen und alles richten. In der
öffentlichen Wahrnehmung und in den Augen der Entscheidungsträger wird
das Potenzial des digitalen Lernens nicht erkannt. E-Learning ist für
viele noch immer eine Notlösung – dabei sollte digitaler Unterricht
mittlerweile zum Alltag der Schüler gehören.
Die Lücke, die durch
Corona entstanden ist, kann nur mit hinreichenden technischen Lösungen
und didaktischen Konzepten für den medialen Fernunterricht gefüllt
werden. Beides suchten die Schulkinder in Deutschland schon vor Corona
vergeblich: Wie der INSM Bildungsmonitor 2019
zeigt, fehlt es weiterhin an einer flächendeckenden und zuverlässigen
technischen Infrastruktur. Den Lehrern wiederum fehlen die nötigen
Kompetenzen, um auch online zu unterrichten. Es ist naiv davon
auszugehen, dass es Schulleitungen, Lehrern und Betreuungspersonen
während der Corona-Krise gelingt, innerhalb weniger Tage ein völlig
ausgereiftes Konzept für das E-Learning zu schaffen.
Universitäten sind einen Schritt voraus
Was nun gebraucht wird, sind pragmatische Kurzfristlösungen. Es gilt, den Schaden, der durch den Unterrichtsausfall entsteht, zu begrenzen. Die Schulen sollten Schulplattformen oder Werkzeuge der Kultusministerien und Landesmedienzentren für die Kommunikation mit den Schülern sowie zur Verteilung von Lehrmaterialien nutzen, um Fernunterricht zu ermöglichen. Hier zahlt es sich aus, wenn Schulen einen guten Medienentwicklungsplan erarbeitet haben, wie er auch im Zuge des „DigitalPakt Schule“ gefordert wurde. Lehrer sollten sich über verfügbare Lern-Apps und freie digitale Lernressourcen informieren und diese an die Schüler weitergeben. Der Austausch von erfolgreichen Konzepten sollte vorangetrieben werden, wie es bereits auf Twitter mit dem Hashtag „#Twitterlehrerzimmer“ geschieht. Auch ein Blick auf die Universitäten lohnt sich: Hier wird bereits seit vielen Jahren das Material online bereitgestellt. Vereinzelt werden sogar ganze Vorlesungen als Video aufgenommen oder live gestreamt.
Mit einem Mindestmaß an Kreativität und Aufgeschlossenheit ließe sich das kommende unterrichtsfreie Zeitfenster zumindest als Erfahrungsraum für Lehrer und Schüler öffnen. Langfristig muss eine digitale Infrastruktur aufgebaut werden, um die Potenziale des digitalen Lernens zu nutzen. Nachhaltige Investitionen, auch in die Beteiligten, sind gefragt, damit E-Learning in Zukunft keine Notlösung mehr ist.
Quelle: www.iwkoeln.dehttp://www.iwkoeln.de