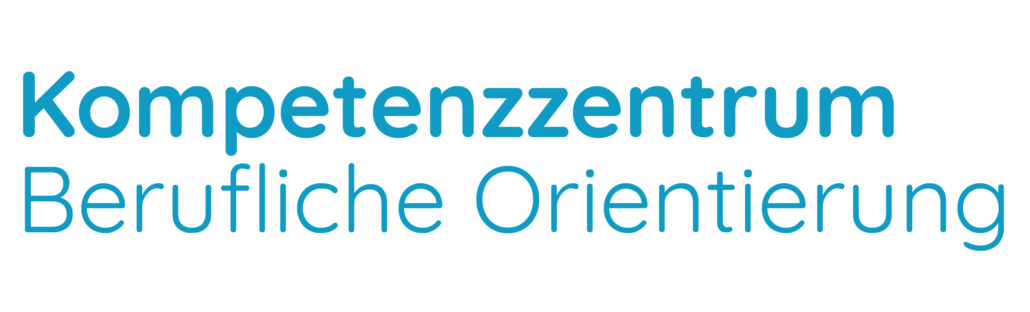Chancengleichheit in der Bildung – Ein Blick auf den Bericht der Enquetekommission des Landtages NRW
Was ist eigentlich aus dem großen Ziel geworden, allen Kindern in NRW die gleichen Bildungschancen zu geben – unabhängig von Herkunft, Wohnort oder familiärem Hintergrund? Dieser Frage ist in den vergangenen zwei Jahren die Enquetekommission des nordrhein-westfälischen Landtages auf den Grund gegangen. Eingesetzt wurde das Gremium auf Wunsch der SPD, nachdem Jochen Ott im Mai 2023 den Fraktionsvorsitz übernommen hatte. Mit Vertreterinnen und Vertretern aller Landtagsfraktionen sowie externen Fachleuten wollte man eine umfassende Bestandsaufnahme und konkrete Handlungsempfehlungen für eine gerechtere Bildungslandschaft in NRW erarbeiten. (Foto: Berichterstatterin Christin Siebel, MdL; Quelle: SPD).
Nun liegt der Abschlussbericht vor – mit 248 Handlungsempfehlungen, einem politischen Kraftakt und nicht zuletzt viel Diskussionsstoff.
Orientierung am „Hamburger Modell“ – Ein Fortschritt oder Rückschritt?
Kern des Berichts ist die deutliche Annäherung an das sogenannte Hamburger Modell, das dort bereits vor über zehn Jahren für umfassende Schulstrukturreformen gesorgt hat. In Hamburg wurden die klassischen Schulformen Hauptschule und Realschule abgeschafft, es gibt nur noch zwei weiterführende Schulformen. Ganztagsunterricht und ein konsequentes, digitales Bildungsmonitoring prägen das neue System. Und ja – in Vergleichsstudien hat sich Hamburg seither verbessert.
Für Nordrhein-Westfalen heißt das: Die Richtung ist klar – Förderschulen, Haupt- und Realschulen sollen auf mittlere Sicht zurückgedrängt werden, auch wenn das System hier noch nicht komplett umsetzbar scheint. Eine gemeinsame Schule bis Klasse 6 – wie in Hamburg – stand in NRW bislang nicht zur Debatte. CDU und Grüne sprechen sich sogar ausdrücklich gegen eine neue Strukturdebatte aus. Dennoch – die Weichen werden gestellt.
Große Worte, wenig Konkretes?
Der Bericht selbst ist durchzogen von Allgemeinplätzen und teilweise schwer verständlichen Formulierungen. Aussagen wie „Ohne Chancengleichheit keine Chancengerechtigkeit“ oder tiefphilosophische Ausführungen zur „Raumtheorie in der Kindheitsforschung“ wirken auf viele Beteiligte aus Schulen, Elternräten oder Jugendhilfeeinrichtungen schlicht abgehoben.
Zugegeben: Einige Formulierungen klingen akademisch, andere beinahe banal. Wer täglich mit Jugendlichen arbeitet, fragt sich, wie viel Praxisbezug wirklich in diesen 248 Empfehlungen steckt.
Und doch – es gibt auch konkrete Vorschläge, die durchaus Gewicht haben:
-
Ein verpflichtendes „Chancenjahr“ vor der Einschulung soll eingeführt werden – als Antwort auf große Unterschiede bei Schulanfänger:innen.
-
Die frühkindliche Bildung soll gestärkt und besser verzahnt werden mit Schule und Jugendhilfe.
-
Die Ganztagsbetreuung soll ausgebaut und qualitativ verbessert werden.
Alte Ideen neu verpackt?
Ebenfalls wieder auf dem Tisch: die Primusschule – ein Modell des längeren gemeinsamen Lernens von Klasse 1 bis 10. Besonders die Grünen machen sich erneut stark dafür, dieses Modell stärker zu etablieren. Doch bisher konnte sich dieses Konzept in NRW nicht durchsetzen – auch wegen fehlender Akzeptanz vor Ort und begrenzter Ressourcen.
Wie neu sind also die Ideen, die nun als „Empfehlungen“ im Bericht stehen? Vieles klingt vertraut – und auch das ist ein Kritikpunkt vieler aus der Bildungspraxis: Der Bericht wiederholt zu häufig alte Forderungen, ohne die Frage zu beantworten, warum diese bisher nicht funktioniert haben – und was diesmal anders gemacht werden soll.
Sondervoten, Kritik und ein offener Dissens
Wie zu erwarten war, hat die AfD alle Handlungsempfehlungen abgelehnt. Zwar teilt sie einige Zielsetzungen – z. B. die Forderung nach kleineren Klassen und mehr Lehrkräften –, doch sie verweigert sich dem Gesamtpaket. Besonders auffällig: das umfangreiche Sondervotum von Helmut Seifen, ehemaliger Lehrer und aktueller bildungspolitischer Sprecher der AfD. Seine Repliken wurden in den Bericht aufgenommen, auch wenn sie wenig mit dem Konsens des restlichen Gremiums gemein haben.
Und was heißt das nun für die Bildung in NRW?
Was bleibt, ist ein Bericht, der viel in Bewegung bringen könnte – wenn der politische Wille vorhanden ist. Einige Empfehlungen könnten realistisch schon bald umgesetzt werden, andere werden sicher in den Programmen zur Landtagswahl 2027 eine Rolle spielen. Fest steht: Bildung in NRW braucht dringend neue Impulse – aber auch Mut, alte Strukturen aufzubrechen und echte Praxisnähe herzustellen.
Ein positiver Ausblick
Trotz aller Kritik: Es ist gut, dass die Diskussion um Chancengleichheit in der Bildung auf die politische Agenda zurückgekehrt ist – und das mit einer breiten Beteiligung aus Politik und Fachwelt. Der Weg zur echten Bildungsgerechtigkeit ist lang, aber jeder Schritt, der die Bedingungen für Kinder verbessert – sei es durch frühzeitige Förderung, kleinere Klassen, mehr qualifiziertes Personal oder einen respektvollen Umgang mit Vielfalt – ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Die wichtigste Botschaft bleibt: Jedes Kind verdient die bestmögliche Bildung. Nicht irgendwann – sondern jetzt.
Den Bericht der Enquetekommission finden Sie hier: https://kurzlinks.de/6a22