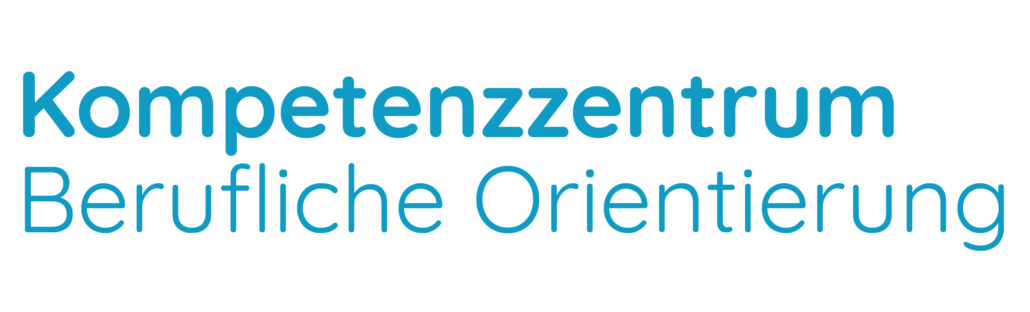Bildungspolitik ist die neue Wachstumspolitik – Warum wir jetzt handeln müssen
Während die große Politik noch über Koalitionsverträge verhandelt, liegt der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes längst auf dem Tisch – oder besser gesagt: im Klassenzimmer, in der Kita, in der Hochschule und im Ausbildungsbetrieb. Die neue Sonderanalyse der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) bringt es auf den Punkt: Bildungspolitik ist Wirtschaftspolitik. Und sie ist der stärkste Hebel gegen Fachkräftemangel, Innovationsschwäche und die Folgen des demografischen Wandels.
Die Studie, durchgeführt vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW), zeigt eindrücklich: Wenn wir Bildung weiterhin als isolierte Aufgabe betrachten – losgelöst von den großen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen – riskieren wir eine Verschärfung zentraler Probleme. Wenn wir Bildung aber als integrierten Bestandteil einer modernen Wachstumspolitik begreifen, eröffnet sich ein enormes Potenzial für wirtschaftliche Stabilität, soziale Teilhabe und innovative Stärke.
Die Fakten: Deutschland verliert an Bildungskraft
Aktuelle Schulleistungsstudien wie PISA und der IQB-Bildungstrend belegen: Die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler nehmen ab. Besonders problematisch ist dabei, dass soziale Herkunft und Bildungserfolg wieder enger miteinander verknüpft sind – mit fatalen Folgen für Kinder aus bildungsfernen Haushalten und mit Migrationshintergrund. Schlechte Deutschkenntnisse, fehlende individuelle Förderung und mangelnde strukturelle Unterstützung verhindern, dass Talente entdeckt und gefördert werden.
Bildung ist kein Kostenfaktor – sie ist ein Investment
Die Analyse zeigt deutlich: Investitionen in frühkindliche Bildung, gezielte Förderung benachteiligter Kinder und Jugendliche sowie die Integration internationaler Studierender bringen nicht nur gesellschaftlichen, sondern auch finanziellen Gewinn. So könnte etwa das Startchancen-Programm, das besonders förderbedürftige Schulen unterstützt, bei einer erfolgreichen Ausweitung langfristig bis zu 92 Milliarden Euro an Mehreinnahmen für die öffentlichen Haushalte bringen.
Ebenso zeigt sich: Die gezielte Zuwanderung über Hochschulen ist ein unterschätzter Wachstumsmotor. Internationale Studierende, die in Deutschland bleiben, zahlen sich aus – sowohl volkswirtschaftlich als auch gesellschaftlich. Die Zahlen sprechen für sich: 7 bis 26 Milliarden Euro an Nettoerträgen durch zusätzliche Hochschulabsolvent:innen aus dem Ausland. Und das bei einer schnellen Amortisation der Investitionen.
Was jetzt zu tun ist
-
Frühkindliche Bildung massiv ausbauen – denn hier entstehen die Grundkompetenzen, die später über Bildungserfolg und Berufschancen entscheiden.
-
Schulen gezielt fördern, in denen besonders viele Kinder zusätzliche Unterstützung brauchen – mit Ganztagsangeboten, Sprachförderung und individueller Begleitung.
-
Internationale Talente willkommen heißen, indem wir Hochschulzugänge erleichtern und Perspektiven für den Verbleib in Deutschland schaffen.
Unser Fazit
Wer heute Bildung vernachlässigt, spart am falschen Ende – und riskiert unsere wirtschaftliche Zukunft. Wer Bildung dagegen als integralen Bestandteil der Wachstums-, Fachkräfte- und Innovationsstrategie denkt, investiert in Stabilität, Chancengleichheit und Wettbewerbsfähigkeit. Die neue Bundesregierung – egal in welcher Konstellation – wird an der Bildungspolitik gemessen werden. Es ist höchste Zeit, dass sie Chefsache wird.